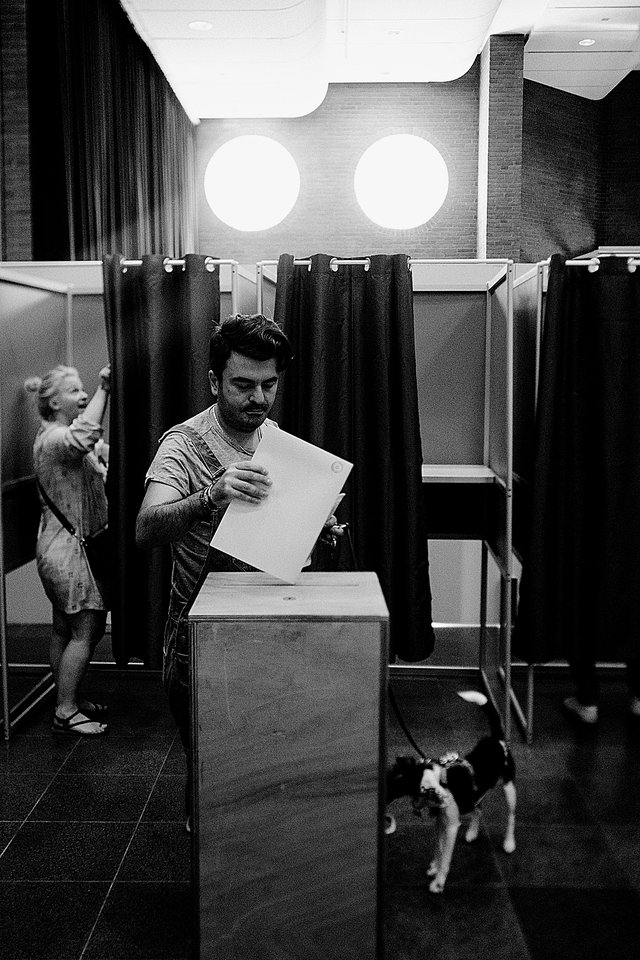Hält das? fragte die Zeit vor knapp einem Monat. Die Rede ist von der amerikanischen Demokratie seit dem Amtsantritt des Präsidenten Donald Trump. Ähnliche Fragen stellt man sich in Europa und hierzulande. Die Ereignisse überschlagen sich in den Staaten, wo der Präsident auf X schreibt: „He who saves his country does not violate any law.“ Mit Musks Ernennung an das Department of Government efficiency (DOGE) werden nach außen hin Zeichen gesetzt. Verwaltungen werden aufgelöst, Bürokratie abgebaut. Der Begriff Effizienz ist nicht harmlos. In einer im Vereinigten Königreich durchgeführten Umfrage gaben knapp mehr als die Hälfte der jungen Menschen zwischen 13 und 27 Jahren an, sich der Effizienz der Demokratie als politischen Systems unsicher zu sein und eine autoritäre Figur vorzuziehen, die sich nicht mit „Wahlen und Parlamenten“ herumschlagen muss.
Vor zwei Wochen haben sich acht Jungpolitiker, Jessie Thill und Fabricio Costa von Déi Gréng, Michael Agostini und Jana Degrott (DP), Jill Goeres und Vincent Reding (CSV) sowie Danielle Filbig und Sammy Wagner (LSAP) an den Präsidenten des Parlaments gewandt, um ihre Sorge um die Demokratie auszudrücken. Allen voran Desinformation und die Einflussnahme auf Social Media könnten zur Erosion des Systems führen – deswegen sollten seine Schwachstellen dahingehend geprüft werden. Es folgte ein Treffen mit dem Präsidenten des Parlaments Claude Wiseler (CSV) und dem Premier Luc Frieden (CSV). Beide zeigten sich von der Idee angetan, einen solchen „Stresstest“, wie es ihn auch im Finanzbereich gibt, durchzuführen. Mittlerweile wurde die Cellule scientifique des Parlaments beauftragt, mögliche Pisten auszuarbeiten, um gegen einen „Sturm auf den Staat“ gewappnet zu sein – die ersten Überlegungen sollen noch dieses Jahr besprochen werden. Auch, weil die Entwicklungen weltweit rasant sind, soll dieser Prozess noch in diesem Jahr beginnen.
Es ist ein Aufruf aus der politischen Mitte, der von den Grünen kam. Weder die ADR noch Déi Lénk haben sich ihm angeschlossen. Auf Nachfrage des Land erklärt Jessie Thill (Déi Gréng): „Die ADR haben wir nicht gefragt, to be honest.“ Das sei nach den kürzlichen Äußerungen des Abgeordneten Tom Weidig kein Thema gewesen. Déi Lénk hätten ihrerseits auch über soziale Gerechtigkeit kommunizieren wollen, nicht nur über Demokratie – und man sei sich dadurch nicht einig geworden.
Worum geht es ihnen? „Finden wir den Staat, den es vorher gab, nach vier Jahren noch wieder?“ fragt Michael Agostini (DP) im Gespräch mit dem Land. Die Zivilgesellschaft und ihre NGOS ebenso wie die Medien seien verletzlich, „Saachen, déi séier kippe kënnen“. Dabei ist Luxemburg insbesondere was die Presse angeht ein interessanter Fall: Der politische Konsens ist stabil, doch die Medien hängen wesentlich von staatlicher Finanzierung ab. Das Risiko einer Radikalisierung der Wähler/innen ist wohl niedriger als im Ausland. Doch käme es dazu, könnte eine autoritär gesinnte Partei der pluralistischen Medienlandschaft die Pressehilfe streichen – dafür braucht es nur eine einfache Mehrheit im Parlament – und es würde ein Monopol-Sender, RTL, übrig bleiben. Agostini schätzt den „gemeinsamen Nenner“ in Bezug auf die Demokratie in der – wahlberechtigten – luxemburgischen Gesellschaft immer noch auf 90 Prozent. Szenarien, die dazu beitragen könnten, das zu verändern, seien eine Rezession, eine sich verschlimmernde Wohnungskrise und mehr Armut; all das könnte auch hier eine Radikalisierung zur Folge haben. „Es gilt, die Barrieren zu verstärken, sodass Wähler die Möglichkeit haben, eine Regierung wieder abzuwählen. Die konstitutionelle Demokratie darf nicht mühelos ummodellierbar sein.“
Dass die Zerbröselung von innen stattfindet, ist eine Entwicklung der letzten zehn Jahren. „Dat ass a mengem Kapp nei, an ech mengen och an de Käpp vun de meeschte Leit nei“, sagt Claude Wiseler (CSV), Präsident des Parlaments im Gespräch mit dem Land. Die Recherchefreiheit zählt er als eine fundamentale Freiheit auf, die geschützt werden müsste. Jessie Thill von den Grünen sorgt sich um die Rechte von Frauen – und will das Recht auf Abtreibung in die Verfassung verankern.
Auch der Justizapparat kann zur Zielscheibe werden. Trump hat in den letzten zwei Wochen begonnen, geltende Gerichtsurteile zu missachten. Alex Bodry, ehemaliger LSAP-Minister und Vize-Präsident des Staatsrats, erklärte kürzlich in einem Interview im Wort, das hiesige System sei ziemlich robust. Radikale Veränderungen seien nicht so einfach umsetzbar. Das Verfassungsgericht etwa ist in der Verfassung festgeschrieben, die Richter werden von anderen Richtern nominiert und garantieren seine Unabhängigkeit.
Am Dienstagnachmittag hatte der liberale Abgeordnete André Bauler angesichts all dieser Entwicklungen dann zu einer Debatte über die Demokratie und Versuche, sie zu destabilisieren, aufgerufen. Sie illustrierte bilderbuchhaft, wie die Parteien sich hierzu positionieren – und wie sie sich in endlosen Plattitüden verlieren, obwohl sie doch kundtaten, keine Sonntagsreden halten zu wollen. „Wie bringt man auch Erwachsene dazu, kritisch zu denken? Demokratie ist kein Selbstläufer. Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken“, fing André Bauler an. Laurent Zeimet (CSV) übte sich in konzilianten Metaphern: „Man muss nach einem Streit auch einen Patt trinken gehen können. Demokratie ist kein Theater, wo die einen auf der Bühne stehen und die anderen zuschauen.“ In den Medien sehe er Nachholbedarf, alle Meinungen wiederzugeben. Die LSAP-Fraktionspräsidentin Taina Bofferding bekannte sich zur Sozialdemokratie, forderte das Wahlrecht ab 16 Jahren und eine Reform des Wahlsystems.
Fred Keup (ADR) meinte, manche Parteien seien vielleicht überrascht, was vor 50 Jahren noch in ihren Programmen gestanden hätte. Außerdem würde Demokratie auch bedeuten, andere Meinungen und „den politischen Gegner zu respektieren“. Die grüne Oppositionschefin Sam Tanson zitierte in ihrer Rede in abgeänderter Art sowohl T.S Eliot (die Demokratie ende „nicht mit einem Knall sondern einem Wimmern“), als auch Jürgen Habermas. Schließlich sprach Sven Clement (Piraten) über die Notwendigkeit der „Ehrlichkeit“ und „Transparenz“ der Politiker, die ja auch „Fehler machen“ und Marc Baum (Déi Lénk) forderte die Abschaffung des Kapitalismus und die Umverteilung des Reichtums als Lösung des Demokatriedefizits – und zitierte Horkheimer. Premier Luc Frieden hatte das Schlusswort und betonte die Notwendigkeit von „Checks und Balances“, einer lebendigen Erinnerungskultur, Bildung und Menschenrechte. Schlauer war man nach diesen Reden kaum.
Seit zehn Jahren ist Luxemburg dem Fragile States Index nach in den Top 10 der stabilsten Länder der Welt. Der Index zieht bei dieser Auswertung Faktoren wie soziale Kohäsion, ökonomische Faktoren, politische Institutionen und den funktionierenden Rechtsstaat, ebenso wie Menschenrechte und sozialen Druck wie etwa die demographische Entwicklung in Betracht. Auch der Democracy Index 2024, ermittelt von der Economist Intelligence Unit, bestätigt die privilegierte Stellung Luxemburgs (Platz 10 weltweit; die politische Partizipation könnte verbessert werden).
Die hiesige politische Klasse weiß dennoch um die Abhängigkeit von den großen Nachbarn. Der reale Stresstest liegt im direkten Ausland. In Frankreich haben die Europäischen Grünen bereits vor drei Jahren ein Gedankenspiel vorgelegt mit dem Titel La résistance du système juridique français à un potentiel choc autoritaire. Ihr Fazit ist eher ernüchternd: „La France semble particulièrement mal placée pour résister à un processus de démantèlement des contre-pouvoirs qui serait organisé par une nouvelle majorité autoritaire. La société civile, traditionnellement faible en France, a été encore plus affaiblie dans les dernières années.“ Besonders unwahrscheinlich ist das Szenario einer Marine le Pen als Präsidentin nicht. Eine Ipsos-Umfrage kommt im Hexagon zum Schluss, dass von den 25 Prozent der Franzosen, die am wenigsten an die Demokratie glauben, die jungen Menschen und die sozial Schwachen überrepräsentiert sind. Ein nicht unwichtiger Teil der Bevölkerung nimmt die politische Klasse als abgehoben wahr – 24 Prozent wünschen sich, dass mehr Menschen ihnen zuhören und ihre Sorgen einbeziehen, 16 Prozent wollen eine Weiterentwicklung der Gouvernance und der Institutionen. Lediglich fünf Prozent sehen in der Verringerung der Ungleichheiten eine Lösungsmöglichkeit – das zeigt, dass die Sorgen sich in erster Linie um das eigene Leben und die direkte Umgebung drehen und selten systemisch gedacht wird.
In Deutschland erhielt die AfD 20 Prozent bei den Bundestagswahlen – bisher wird sie als Koalitionspartnerin ausgeschlossen. Die SPD-nahe Friedrich Ebert Stiftung (FES) zeichnet in ihren Umfragen ein gemischtes Bild der Stimmungslage. Mehr als 50 Prozent der Befragten sind mit dem Zustand der Demokratie unzufrieden. Demokratieskeptiker sind oft sozial Schwache, die das System zunehmend als Eliteprojekt wahrnehmen. Auch eine Radikalisierung der Ränder beobachtet die FES: Sie hält fest, dass die Pandemie und der Krieg in der Ukraine eine starke Polarisierung in der deutschen Gesellschaft verursacht haben, von denen die politischen Ränder profitieren. Was bedeutet das für Luxemburg, wenn Marine Le Pen oder Alice Weidel das Ruder nebenan übernehmen? Es seien zunächst „ökonomische“ Konsequenzen, erklärt Claude Wiseler. Die „Einflüsse“ seien die zweite Konsequenz. „Ich weiß auch nicht, wie man sich dagegen wehren soll. Damit müssen wir leben.“
Eine rezente Studie der Uni.lu zeigt, dass das Interesse an Politik bei den 12- bis 29-Jährigen in den letzten fünf Jahren abgenommen hat, und dass etwa die Hälfte glaubt, dass Politiker/innen sich nicht darum kümmern, was junge Menschen denken – und nur daran interessiert sind, wiedergewählt zu werden. Obwohl die Gen Z sich um die gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere den Kriegsausbruch sorgt, gibt knapp die Hälfte an, nicht zu wissen, wie sie politisch Einfluss nehmen kann – und zwei Drittel von ihnen sind der Ansicht, sie müssten mehr Mitspracherecht haben. Die Forscher/innen kommen zum Schluss, dass sie sich deswegen im „sozialen Nahraum“ engagieren, während politisches und zivilgesellschaftliches Engagement wenig ausgeprägt ist.
Um mehr politische Teilhabe zu ermöglichen, war die Idee eines begleitenden Bürgerrats für den Stresstest ebenfalls von den acht Poltiker/innen aufgeworfen worden. Obwohl Premier Frieden sich in diesem Fall für eine solche Bürgerbeteiligung ausgesprochen hatte, wurde eine entsprechende Resolution von Sam Tanson am Dienstag von der CSV und der DP abgelehnt. Immerhin seien es sie, die gewählten Vertreter des Volkes, die Dinge zu entscheiden hätten, sagte der CSV-Abgeordnete Laurent Zeimet.